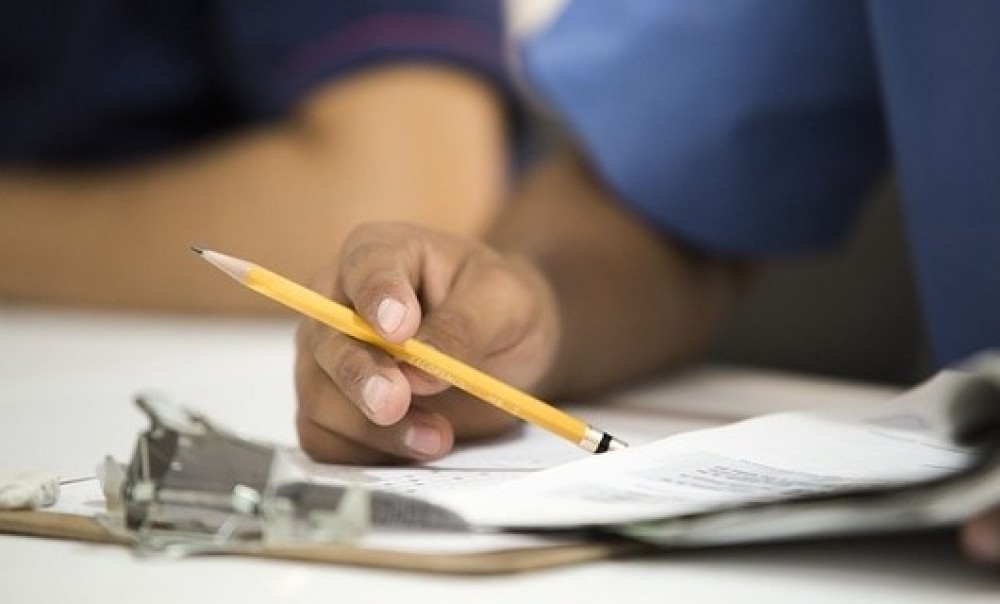Anders als junge Menschen, die aus ihrem Elternhaus ausziehen und weiterhin auf familiäre Unterstützung zählen können, stehen junge Menschen, die für eine Zeit in stationären Hilfen zur Erziehung – z. B. Wohngruppen oder Vollzeitpflege – aufgewachsen sind, sogenannte Careleaver*innen, plötzlich ohne Netz und doppelten Boden da. Keine Familie, die Sie auffängt, kein finanzielles Polster, das sie absichert.
Die erste eigene Wohnung? Kaum bezahlbar. Sozialleistungen? Wochenlange Wartezeiten und komplizierte Anträge – und dann die Forderung, das Einkommen Ihrer Eltern nachzuweisen. Doch viele Careleaver*innen haben aus guten Gründen keinen Kontakt zu ihren Eltern. Sich aus der Abhängigkeit von den Eltern zu lösen, ist häufig der Grund, warum sie zu ihrem Schutz in Einrichtungen oder Pflegefamilien leben.
Erschwerte Startbedingungen
Diese Unsicherheiten sind für viele junge Menschen nach der Jugendhilfe Alltag. Während Gleichaltrige auf die Unterstützung ihrer Familien zählen können, bleiben Careleaver*innen oft auf sich allein gestellt. Der Staat erkennt im Jugendhilfesystem zwar an, dass eine Rückkehr in die Familie nicht zumutbar ist – doch im Sozialrecht werden sie wie alle anderen jungen Erwachsenen behandelt. Dies führt zu zusätzlich erschwerten Startbedingungen, verzögerten Ausbildungen, prekären Lebenslagen und im schlimmsten Fall zu existentiellen Notlagen wie Wohnungslosigkeit.
Sozialleistungen, auch ohne Elternkontakt
Careleaver*innen brauchen einen eigenen Rechtsstatus. Ein Status, der ihre spezifische Situation anerkennt und sicherstellt, dass Sozialleistungen – ohne auf Auskünfte der Eltern angewiesen zu sein – gewährt werden und kein Kontakt zu ihren Eltern erzwungen wird. Die Jugendämter kennen ihre Geschichte bereits. Andere Behörden sollten diesen bereits festgestellten Unterstützungsbedarf anerkennen und Daten entsprechend austauschen bzw. beschaffen, statt Careleaver*innen zusätzlichen bürokratischen und potenziell retraumatisierenden Hürden auszusetzen.
Was dieser Status leistet:
- Bürokratieabbau und sicherer Zugang zu Sozialleistungen wie BAföG, Wohngeld oder Grundsicherung.
- Besserer Zugang zu Wohnraum durch vereinfachte Wohnberechtigungsscheine und Unterstützung bei Kautionen.
- Klarer Schutz vor erzwungener Kontaktaufnahme mit den Eltern, etwa bei Anträgen auf Kindergeld oder Sozialleistungen.
- Gesicherte Gesundheitsversorgung, insbesondere bei der Krankenversicherung und Psychotherapie.
- Mehr soziale und wirtschaftliche Teilhabe, um Ausbildungsabbrüche, Armut und Wohnungslosigkeit zu vermeiden.
Zeit für Veränderung
Wie der Bundesfamilienausschuss am 5. Juni 2024 fraktionsübergreifend festgestellt hat, stellt die aktuelle Rechtslage Careleaver*innen vor große Herausforderungen und erschwert ihnen den Weg in ein eigenständiges Leben. Ein eigener Rechtsstatus kann diese strukturellen Benachteiligungen abbauen und für mehr Chancengerechtigkeit sorgen.
Quelle: Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH) (Mai 2025)